Hadwig Müller, Aachen (aus dem Referat)
Außerordentliche Gemeindeleitung in pfarrerlosen Pfarreien
Adrian Lauretan, Schweiz
Grenzüberschreitung oder/und kreative Treue
Ein Kurzbericht aus den Niederlanden (Gerard Zuidberg, Utrecht)
Die Bedeutung von "parish leadership" durch Laien
Eine analytische Studie zu c. 517 § 2 CIC und Erfahrungen in Asien, besonders Indien (Alex Vadakumthala, North India)
Zur Situation der Gemeindeleitung in Kinshasa
Marco Moerschbacher, Leuven (aus dem Referat)
Die Bedeutung des Canon 517 § 2 CIC in Nordamerika
Bryan Froehle, Miami/Florida (aus dem Referat)
Überlegungen zu Klerikern und Gemeindeleitung in der Kirche
Alfons Vietmeier, Mexiko (aus dem Referat)

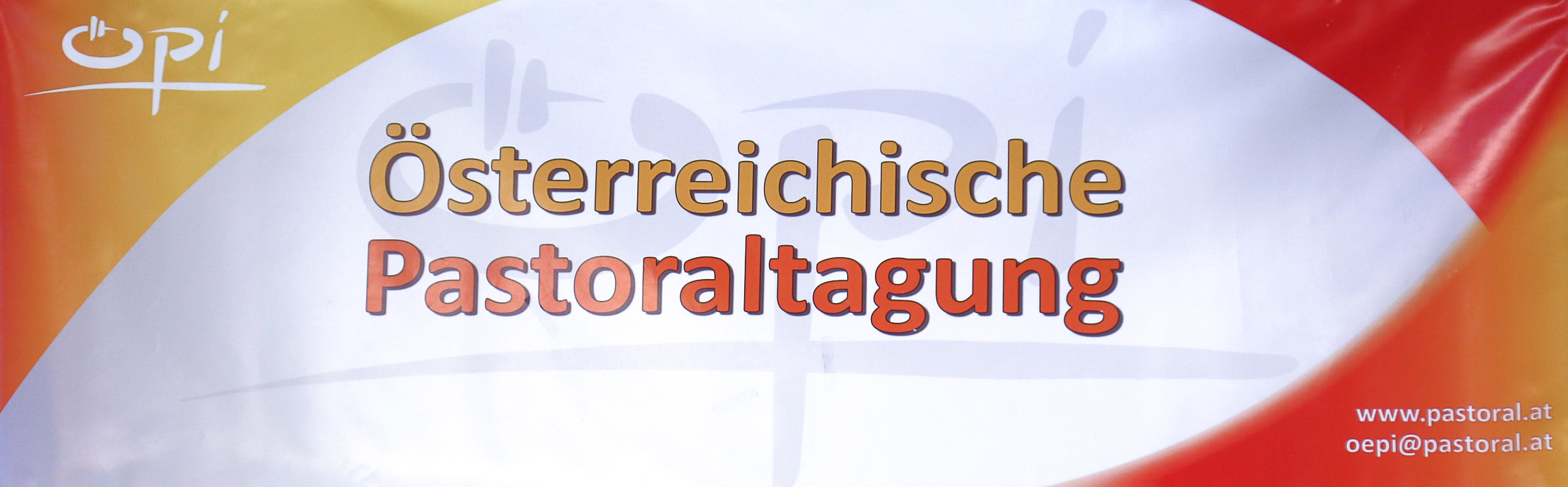

 Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem
Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem