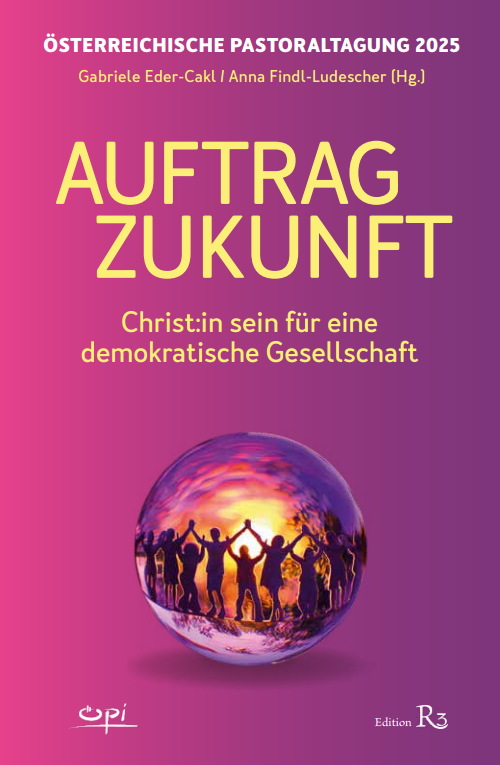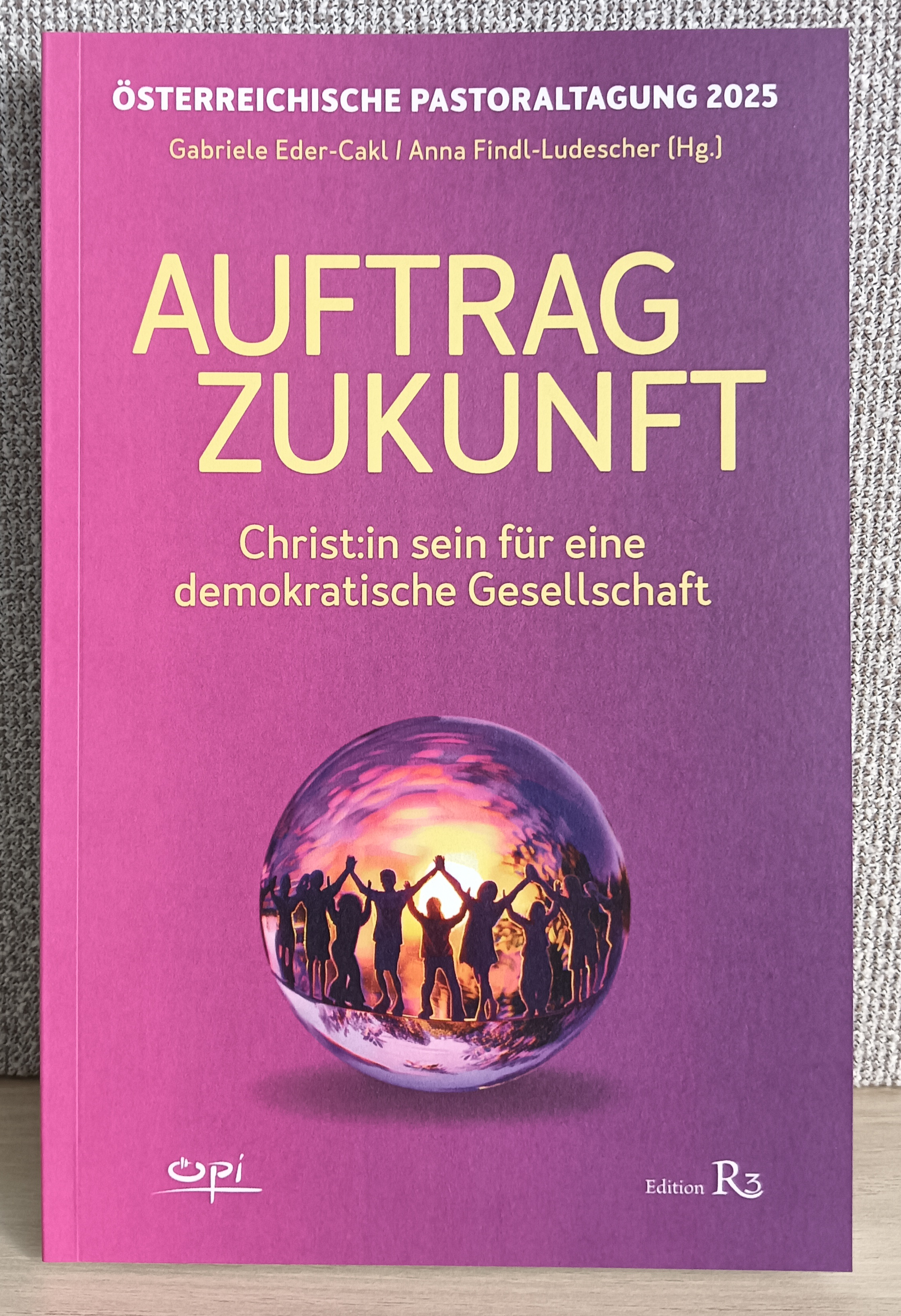
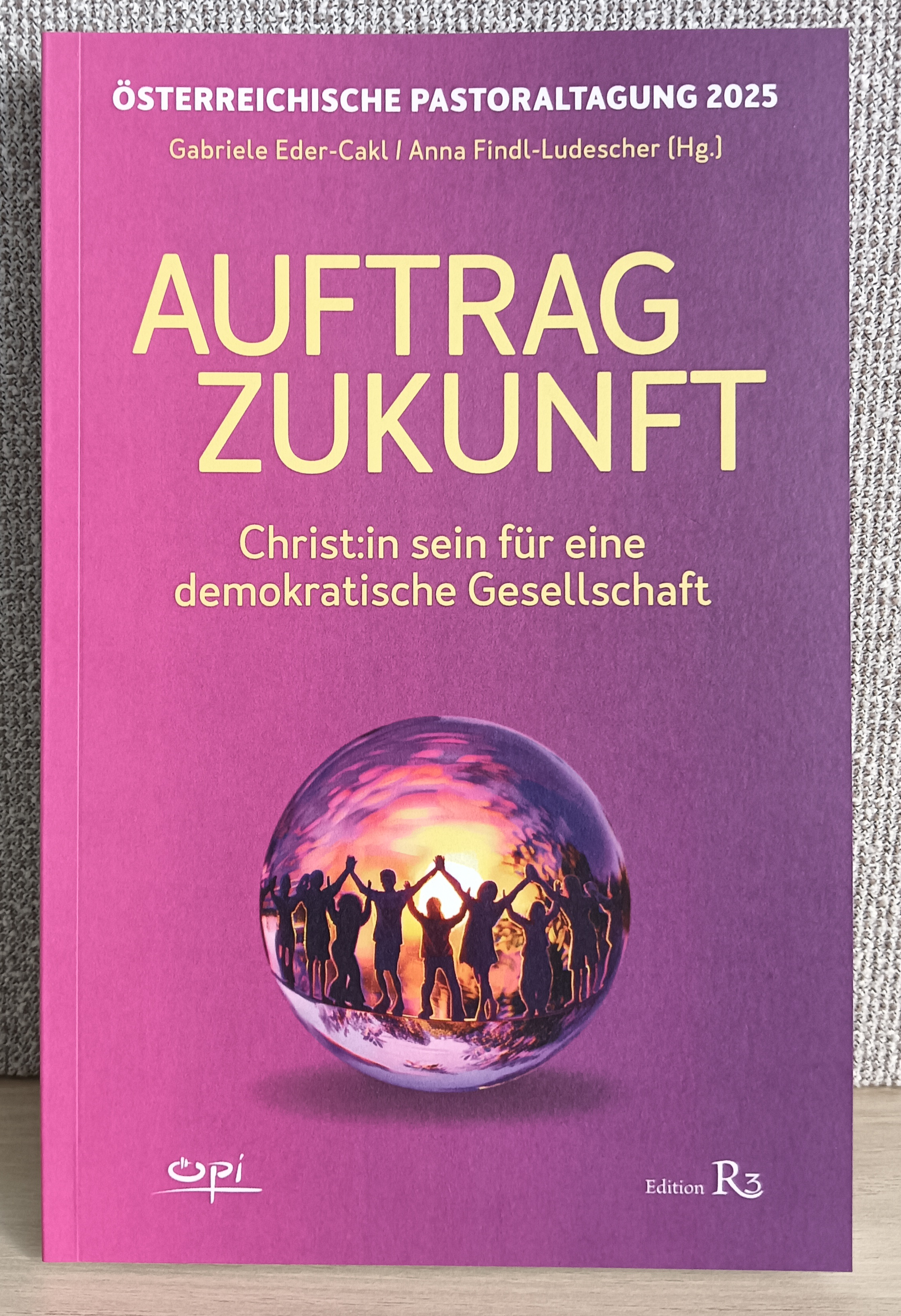
"Auftrag Zukunft - Christ:in sein für eine demokratische Gesellschaft"
Hunderte Ferienlager und Angebote für Kinder in Österreichs Pfarren
"Lange Nacht der Kirchen" heuer österreichweit am 23. Mai

Gemeinsame Tagung der Hauptamtlichen Seelsorger:innen Österreichs
29. - 30. 4. 2025 im Stift Michaelbeuern / Salzburg



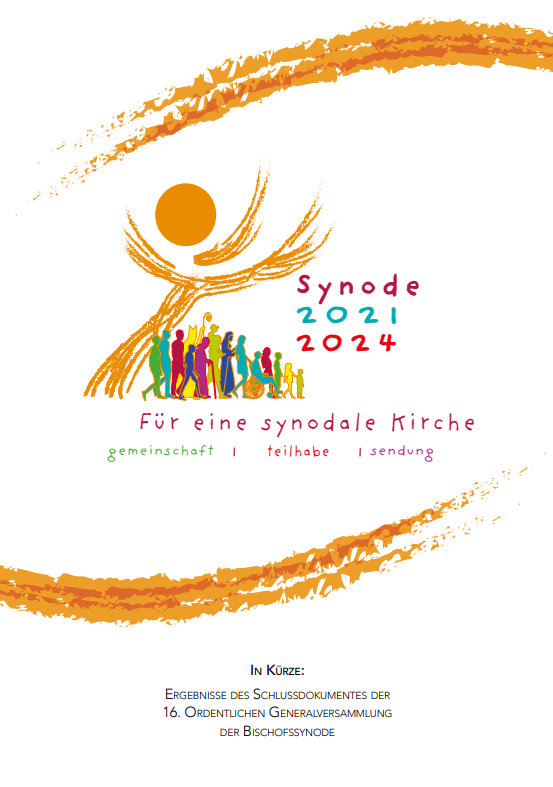


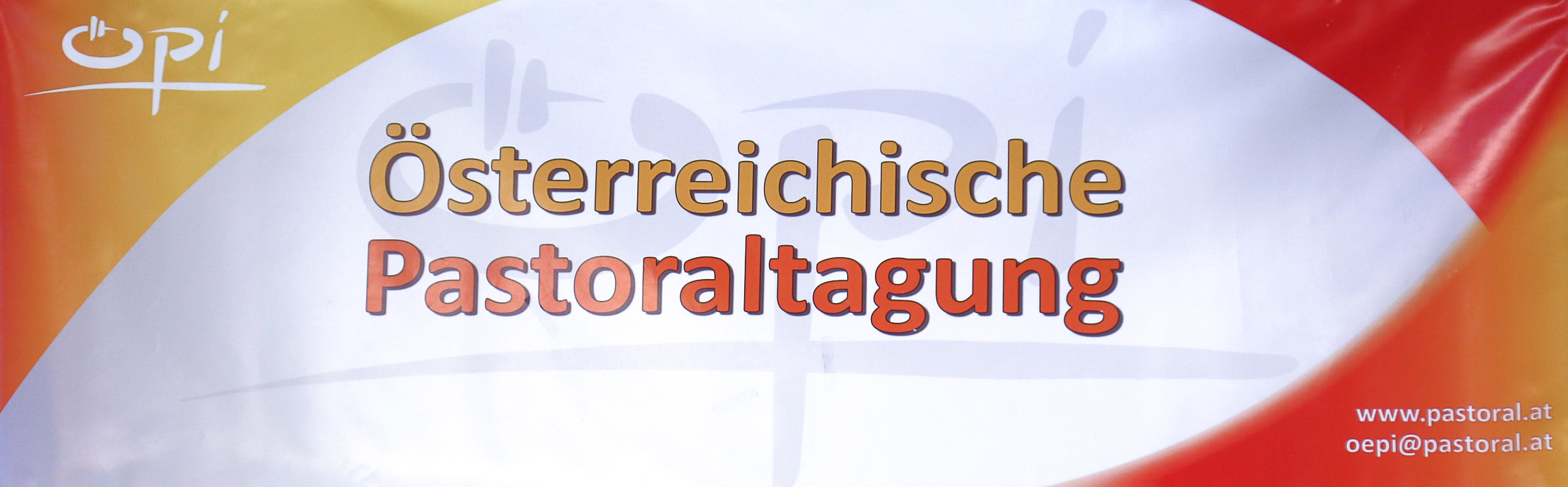

 Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem
Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem