(Servant Leadership)
Inklusion
Impulse für eine einladende Pfarrgemeinde
aus dem Workshop: Mit Kreativität und Wagemut
Gleichwertigkeit und Gerechtigkeit für Mann und Frau
Pluralität - kein "Schonprogramm" ...
Handout von Dr. Eva Grabherr
Wieviel Heterogenität verträgt - braucht - liebt die Kirche?
Handout von Prof. Dr. Hildegund Keul
Schwerter zu Pflugscharen ... Pluralität und Identität in der Bibel
Handout von Prof. Dr. Ulrike Bechmann
Kulturelle Identität in einer pluralen Gesellschaft ...
Handout von Mag. Amani Abuzahra

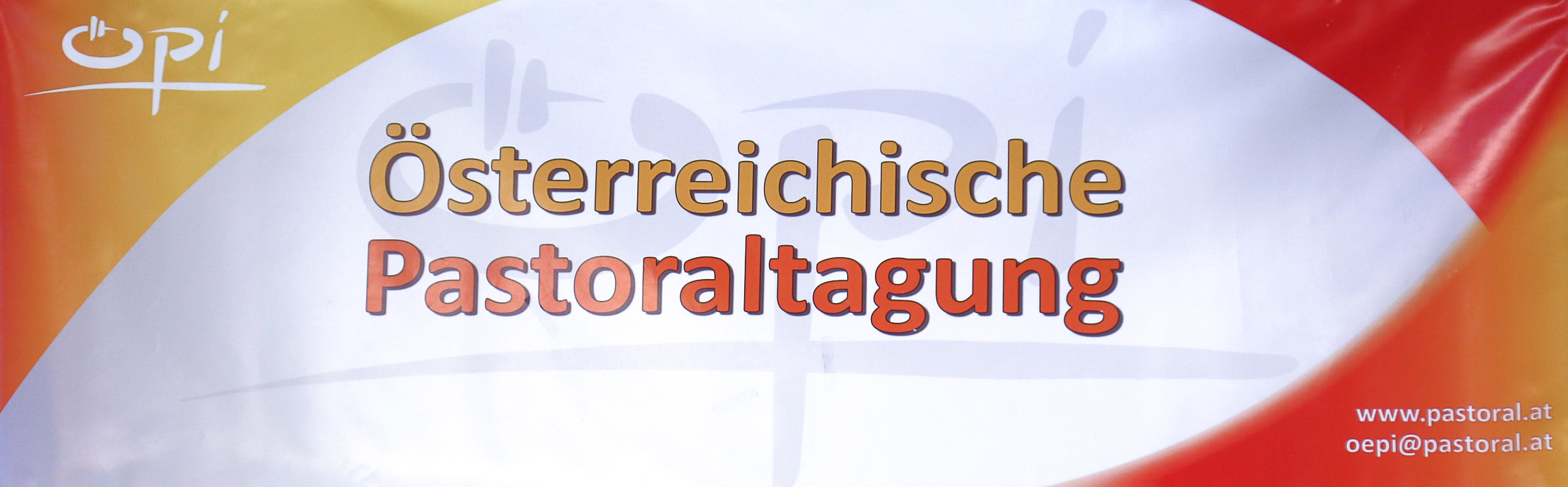

 Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem
Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem