Aus dem Referat Christian Schemer
Die Kirche als politische Volkskirche.
Aus dem Referat Ulrich Körtner
Phänomene des Populismus: Religion.
Aus dem Referat Jan-Werner Müller
Auf dem Weg zu einer Leutetheologie.
Aus dem Referat Christian Bauer
Populismus in Kirche und Religion.
Aus dem Referat Antja Schrupp
Kirche und Polarisierungen.
Aus dem Referat Gerd Pickel
Populistische Kommunikation.
Aus dem Referat Andreas Scheu

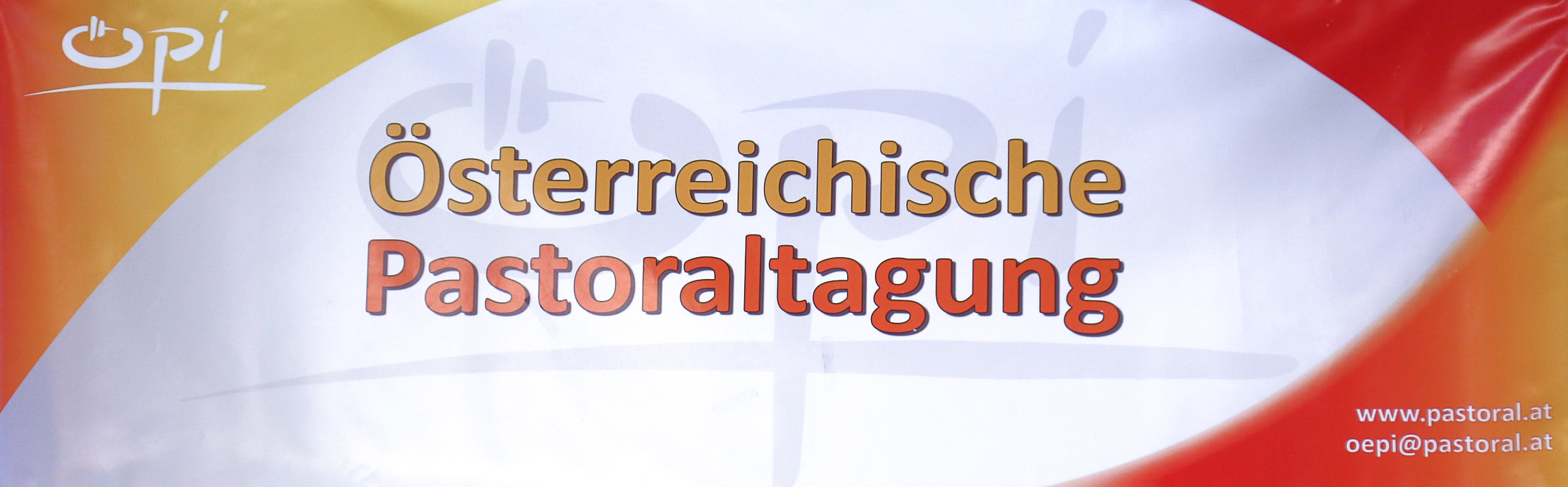

 Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem
Erwachsene entdecken den Glauben und wollen sich in einem